In den letzten Monaten war der Baumentscheid in Berlin auch in meinem Blog das Wichtigste. Nun braucht es den Volksentscheid nicht mehr: Das Abgeordneten Haus hat am 3.11.25 das Klimaanpassungsgesetz verabschiedet, das bis 2040 eine Millionen Bäume für Berlin vorsieht, für alle Menschen fußläufige Grünflächen und eine Veränderung des Wassermanagements. Vor allem zu der besseren Nutzung des Regenwassers habe ich viel gelesen und geschrieben. In den nächsten Jahren wird es wichtig sein, gerade die bezirklichen Behörden bei der Umsetzung des Gesetzes zu unterstützen.
Rezension: Der Kosmos Baumführer – Europa von Margot Spohn und Roland Spohn
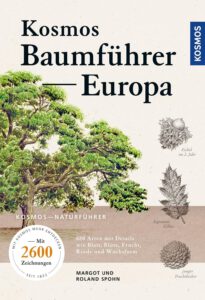 Nachdem mir ein Kosmos Führer derselben Autorin so gut gefallen hatte Rezension: Was blüht denn da? von Margot Spohn, wollte ich auch diesen kennenlernen.
Nachdem mir ein Kosmos Führer derselben Autorin so gut gefallen hatte Rezension: Was blüht denn da? von Margot Spohn, wollte ich auch diesen kennenlernen.
Das BäumePlus Gesetz ist beschlossen!
Ohne Gegenstimmen, mit Enthaltungen der AFD wurde am 3.11. das Gesetz verabschiedet. Und wie geht es nun weiter? Erst einmal bedeutet es, dass die für den 8.12. d. J. vorbereitete Unterschriftensammlung nicht nötig ist. Nun gilt es, die Energien auf die Schritte der Umsetzung zu lenken. Am 4.12. findet der 10. Baumsalon statt link Sichern Sie sich eine kostenlose Eintrittskarte!
Vogelfutter kann für Katzen giftig sein!
Wir füttern seit Langem Vögel: in meinem Buch schwärme ich davon und beschreibe auch, wie mein Mann Vogelfutter mixt mit: Haferflocken, Mehlwürmern und Rosinen. Vögel füttern
Wenn ich das noch einmal lese, werde ich ganz nostalgisch, denn es gibt kaum noch Vögel, nicht mal Spatzen. Einige Meisen, mal ein Eichelhäher, mal ein Rotkehlchen. Den Artenschwund gibt es also auch mitten in der Stadt, wo kaum Gifte, die dann auch noch Pflanzenschutzmittel heißen, eingesetzt werden. Rezension: Die Akte Glyphosat von Helmut Burtscher-Schaden
Neues vom BaumEntscheid (Stand September 2025)
„Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen,
war vor zwanzig Jahren.
Die nächstbeste Zeit ist jetzt.“
Jetzt Samen für die Einjährigen ernten!
Seit die Enkeltöchter damals, (vor über zehn Jahren) ihre Versuche mit Samentütchen machten, habe ich mich zur Samensammlerin entwickelt, natürlich mit samenfesten Samen!
Rezension: Klimaresilienz Was wir tun können, damit uns die Klimakrise nicht krank macht Die besten Strategien gegen Hitzestress, Extremwetter, neue Krankheiten und seelische Belastungen von Christina Berndt
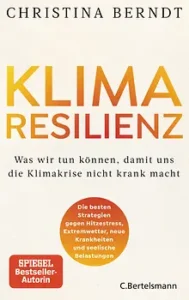 Frau Berndt ist Wissenschaftsjournalistin und schreibt anschaulich, wie Individuen sich ein- und umstellen können, um die kommenden Belastungen besser ertragen zu können—also, wie sie ihre eigene Resilienz verbessern können.
Frau Berndt ist Wissenschaftsjournalistin und schreibt anschaulich, wie Individuen sich ein- und umstellen können, um die kommenden Belastungen besser ertragen zu können—also, wie sie ihre eigene Resilienz verbessern können.
Dabei zitiert sie Wissenschaftler, die in nicht-wissenschaftlichen Medien interviewt werden, gerne aus der Süddeutschen Zeitung, als Quellenangabe. Allerdings gibt es zu jedem Kapitel ausführliche Lese Empfehlungen, insgesamt über zwanzig Seiten.
Das Buch ist in neun Kapitel eingeteilt, mit passenden Überschriften, wie „Ein heißes Thema“ oder „Gefährlich frische Luft“, über Artensterben und das gleichzeitige Auftreten neuer Schädlinge.
In den ersten Kapiteln werden die Veränderungen aufgezählt. Heißer wird es: da hilft schwitzen. Das kann man lernen, indem man öfter in die Sauna geht. Aber, wenn die Luft zu feucht ist, wird Schwitzen schwerer. Der neue „Klimaschick“ sei helle Kleidung, gerne weißes Leinen. Und natürlich viel trinken, da wird Einiges empfohlen. So gibt es eine Fülle von Tipps, die vor allem für Ältere gelten, denn sie sind, wie man weiß, besonders gefährdet.
Als ehemalige Kinderärztin möchte ich die Gefahren für Kinder und Jugendliche herausstellen, denn von ihnen wird hier auch gesprochen.
Es gibt Bekanntes: Nicht in der Anwesenheit Schwangeres rauchen, Stillen, aber Kaiserschnitte nur, wenn nötig! Das empfiehlt auch die WHO. Da das früher eines meiner Themen war, habe ich gegoogelt: In der BRD sind es stabil gut ein Drittel der Geburten, die WHO empfiehlt weniger als die Hälfte davon, besonders schnittbereit sind Geburtshelfer im Saarland, da sind es doppelt so viele. 60%!
Die natürliche Geburt hilft Kindern bei der Ausbildung eines stimmigen Immunsystems und schützt so vor Allergien. Dieses Thema wird, in seiner Widersprüchlichkeit ausführlich und mit neueren Erkenntnissen behandelt.
Auch Erwachsene leiden vermehrt unter Allergien, ein Grund sind die verlängerten Blühzeiten der allergenbildenden Pflanzen.
„Wider das schlechte Gewissen“ zeigt die Schädlichkeit von Fernreisen auf. Wussten Sie, dass private Propellermaschinen noch schädlicher sind? Und dass Taylor Swift Menschen verklagt, die von ihren Privatflügen berichten?
Es kommen Warnungen vor Greenwashing bei Kompensationsangeboten, www.goldstandard.org ist eine gute Adresse, wenn Flugscham auf das Gewissen drückt.
„Luft für die Seele“ zeigt Möglichkeiten auf, um sich vom Klimastress nicht zu sehr runterziehen zu lassen.
Dies gilt für alle, ein Psychiater wird zitiert: “Der Klimawandel ist ein der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit, auch für die Psychiatrie.“
Besonders sind auch hier wieder Jugendliche betroffen, die Psychologists for future sehen eine Zunahme an Depressionen und anderen Störungen.
Deshalb sei es wichtig, die Bedrohung auch immer mit Handlungsmöglichkeiten für dem Einzelnen zu begleiten, auch wenn es nur eine wenig ist, der Seele hilft es. Und auf Erfolge hinzuweisen, etwa, dass das Ozonloch durch gemeinsame weltweite
Anstrengungen wieder geschlossen ist.
Hier das Schlusswort: „Für den Zustand der Erde gilt somit ebenso wie für die Seele des Menschen: Es gibt sie, die Chancen zur Resilienz, auch in Zeiten des Klimawandels. Sie sind überall. Man muss sie nur ergreifen.“
Wässern
 Ich wässere nur, wenn es wirklich nötig ist. So sieht es wahrscheinlich jeder Gärtner, aber ich sehe die Notwendigkeit seltener als meine Nachbarn. Und es gibt keinen Unterschied beim Aussehen und Gedeihen der Pflanzen, höchstens beim Rasen. Der Rasen ist für mich keine Bepflanzung, eher eine Unterlage zum Gehen, deren Pflege ich meinem Mann überlasse. Wenn es zu einer blühenden Wiese kommt, finde ich es eher schön. Aber, um zum Thema zurückzukommen: dem Rasen sieht man schon an, wie oft er bewässert wird.
Ich wässere nur, wenn es wirklich nötig ist. So sieht es wahrscheinlich jeder Gärtner, aber ich sehe die Notwendigkeit seltener als meine Nachbarn. Und es gibt keinen Unterschied beim Aussehen und Gedeihen der Pflanzen, höchstens beim Rasen. Der Rasen ist für mich keine Bepflanzung, eher eine Unterlage zum Gehen, deren Pflege ich meinem Mann überlasse. Wenn es zu einer blühenden Wiese kommt, finde ich es eher schön. Aber, um zum Thema zurückzukommen: dem Rasen sieht man schon an, wie oft er bewässert wird.
Ich wässere sorgfältig nach dem Pflanzen. Die Idee ist, nach dem Einpflanzen alle kleinen Luftbläschen von den Wurzeln zu vertreiben, indem sie nach oben an die Luft gehen. Angepflanztes wird auch in den folgenden Tagen nachgegossen, noch öfter, wenn die Luft trocken ist. Dann gieße ich die Pflanzen, von denen in der nahen Zukunft eine bestimmte Leistung erwartet wird: Blüte und oder Frucht. Wer schon geblüht hat, wird in dieser Saison nicht mehr sonderlich gut bedacht.
Immer etwas mehr Wasser als die anderen Pflanzen bekommen die Hortensien, ihr lateinischer Namen ist Hydrangea, die Wasserschlürferin. Wenn lange Trockenzeit ist, bekommen auch die Rhododendren und die Magnolie Extraschlucke. Dann lege ich den Schlauch an die Wurzeln und lasse lange Zeit ganz feine Tropfen rieseln. Manchmal vergesse ich den Schlauch, und so bekommt die Pflanze über Nacht eine Wasserration, die lange vorhalten soll.
Rosen werden durch Wassergaben an die Wurzeln zum Blühen getrieben, das bilde ich mir wenigstens ein. Bei ihnen ist es wichtig, dass man keine Tropfen auf die Blätter kommen lässt. Die Feuchtigkeit der Blätter fördert eine Zunahme der Pilzkrankheiten. Niemals sollte in der Mittagszeit gegossen werden. Der Sonnenschein kann Tropfen zu Lupen machen und die Blätter verbrennen. Die frühen Morgenstunden oder der Abend werden empfohlen. Da ich morgens lange schlafe, fange ich also abends an mit dem Gießen oder zumindest dann, wenn der zu gießende Teil des Gartens im Schatten liegt.
 Früher hatte ich Kübelpflanzen im Garten verteilt, in schönen Terracottagefäßen, aus Spanien mitgebracht. Diese Kübel werden in Gegenden mit großer Hitze und Wasserknappheit, etwa in italienischen Renaissance- oder Manierismus- gärten eingesetzt. Sie sehen auch hier schön aus, aber inzwischen nutze ich sie nicht mehr:
Früher hatte ich Kübelpflanzen im Garten verteilt, in schönen Terracottagefäßen, aus Spanien mitgebracht. Diese Kübel werden in Gegenden mit großer Hitze und Wasserknappheit, etwa in italienischen Renaissance- oder Manierismus- gärten eingesetzt. Sie sehen auch hier schön aus, aber inzwischen nutze ich sie nicht mehr:
Mir war das regelmäßige Gießen, aber vor allem das Geschleppe der Kübel oder das Warten auf die Person, die für mich schleppt, zu viel. Inzwischen gibt es Kübel eigentlich nur auf der Terrasse, da ist das Gießen einfacher. Und teurer! Denn das Wasser in der Küche, die an die Terrasse angrenzt, kostet mehr als das Wasser aus dem Gartenwasserhahn, der einen anderen Tarif hat. Wenn mir nach Sparen zu Mute ist, schleppe ich die 10 l Kanne die Treppe hoch, wenn es schnell gehen muss, leiste ich mir das „teure“ Wasser aus der Küche. Am liebsten nehme ich gesammeltes Regenwasser, es wird auch immer empfohlen. Wir sammeln das Wasser, welches auf die Terrasse regnet, vielleicht könnte man noch mehr Regenwasser zurückhalten. Bei den derzeitigen Wasserpreisen lohnt es nicht, eine Regenwassertonne anzuschaffen: Mein Mann hat vorgerechnet, dass es sich erst nach über dreißig Jahren rentierte und während dieser ganzen Zeit steht die Tonne in meinem kleinen Garten.
Aber es schmerzt mich, wenn Wasser vergeudet wird. Was ist die Erklärung für meine Wassersparsamkeit? Ich glaube, sie liegt einerseits daran, dass ich als Kind bei Besuchen auf dem Lande noch zum Brunnen ging, in Frankreich und Ungarn. Vor allem liegt es sicher an den vier Jahren in einer trockenen Gegend im Hochland von Tansania. Dort hatten wir, anders als die Dorfbewohner, zwar fließend Wasser im und am Haus, aber von einer Qualität, die von Trocken- oder Regenzeit abhängig war: Wenn es viel regnete, gab es schönes Brunnenwasser, sonst brackiges Oberflächenwasser, welches gefiltert und abgekocht werden musste. Die Dorfbewohnerinnen mussten für so ein Wasser weit laufen und es dann auf dem Kopf nach Hause schleppen. Schon kleine Teenager schafften 20 Liter Eimer, ohne zu wackeln.
Wasserverschwendung stört mich bis heute. Wenn zum Beispiel die Enkelkinder das Wasser in der Küche einfach so laufen lassen, muss ich immer eingreifen, obwohl ich weiß, dass sie das nicht recht verstehen. Wenn der Garten etwas davon abkriegt, schaue ich ihren Wasserspielen geduldig zu, schlage nur vor, dass sie die Spielorte etwas mehr verteilen. Wenn der große Pool im Hochsommer gefüllt wird, trauere ich nicht dem Wasser nach, sondern freue mich, dass es dann, wenn er geleert wird, zu einer riesigen Schwemme für einige der Pflanzen kommt. Dann ist ja nichts vergeudet.
Im Winter wird der Gartenhahn abgestellt. Das gesammelte Regenwasser wird, wenn es im Überfluss anfällt, zu den Hortensien, Rhododendren, Azaleen und zur Magnolie geschleppt, für einen letzten Extraschluck. Von den Kübelpflanzen überwintern manche auf der Terrasse, manche im frostschirmen Wintergarten. Ein wenig Wasser brauchen alle, vor allem diejenigen, die draußen sind, etwa einmal die Woche. Wenn Pflanzen erfrieren, dann geschieht dies über ein Austrocknen der Wurzeln.
Können Städte im Klimawandel grüner werden?
Ja, aber—wäre die kurze Antwort. Wenn sich Techniken und Aufwand der Pflege verbessern, geht die Antwort dann weiter. Aber wie kann das gehen?
Pflanzen mit Überraschungspotenzial
In den ersten Jahrzehnten meines Gärtnerinnenlebens erlebte ich im Garten viele Überraschungen, schöne und weniger schöne: Was mir alles eingegangen ist! Aber davon schreibe ich nur selten, denn meistens konnte ich auch etwas daraus lernen. (Nachruf auf Miss Iffy, Abschiednehmen von Lieblingspflanzen)

